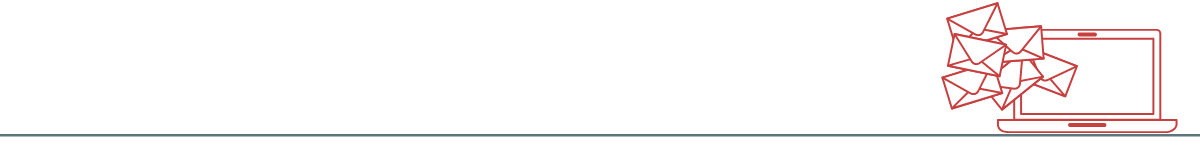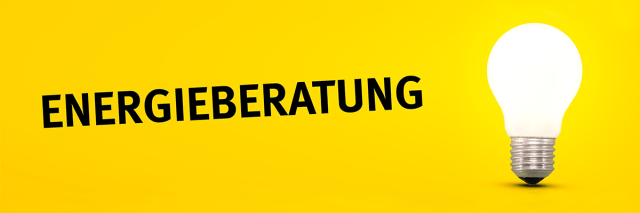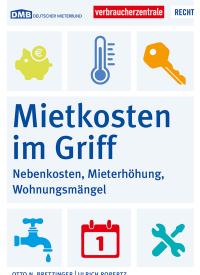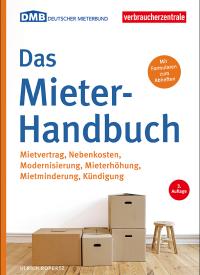Wurde der Bonus richtig berechnet und ausbezahlt?
Beim Anbieterwechsel wird Ihnen oft ein Bonus in Aussicht gestellt. Ein Sofortbonus wird oft schon nach einer bestimmten Belieferungszeit von zum Beispiel 30 Tagen ausgezahlt, ein Neukundenbonus üblicherweise bei der ersten Jahresabrechnung gutgeschrieben. Hier kommt es aber auf die genauen Regelungen in den AGB der Anbieter an.
Rechnen Sie selbst nach, ob der Bonus korrekt ist. Fehlt er oder wurde er falsch berechnet, sollten Sie beim Versorger nachhaken und auf die Gutschrift bestehen.
Sind die Abschläge für Strom oder Gas realistisch?
Die Monatsabschläge müssen den letzten Jahresverbrauch widerspiegeln. Realistische Werte erhält man bei Strom- und Gaslieferverträgen so: Zunächst die Zahl der Kilowattstunden auf der Jahresrechnung mit dem Preis pro Kilowattstunde multiplizieren. Dann den sogenannten Grundpreis für das ganze Jahr hinzurechnen. Zum Schluss die entstandene Summe durch zwölf teilen.
Gibt es keine Daten aus dem Vorjahr, müssen sich Abschläge an vergleichbaren Kunden orientieren. Können Sie glaubhaft machen, dass Ihr Verbrauch etwa nach dem Auszug eines Haushaltsmitglieds zukünftig erheblich sinkt, muss Ihr Energieanbieter die Abschläge angemessen anpassen.
Passen Ihre Abschläge nicht, fordern Sie bei Ihrem Energieanbieter eine Anpassung ein. Das ist in der Regel kein Problem. Im Zweifelsfall können Sie Ihren Anspruch mit Fristsetzung per Einschreiben geltend machen. Ob der Abschlag für Sie passt, können Sie mit dem Rechner der Verbraucherzentralen überprüfen.
Ohne Rücksprache mit dem Energieanbieter sollten Sie Abschläge nicht verringern. Denn wenn Sie unberechtigt kürzen, kommen Sie in Verzug und müssen den Verzugsschaden tragen. Das bedeutet, dass Zinsen fällig werden. Daher sollten Sie das nicht ohne Rechtsberatung, zum Beispiel durch eine Verbraucherzentrale, tun.
Mehrere Anbieter fordern einen deutlich zu hohen Abschlag und nutzen diese Taktik, um sich einen zinslosen Kredit zu verschaffen. In manchen Fällen wird dazu der Verbrauch nicht abgelesen, sondern sehr großzügig geschätzt. Mehr dazu, wenn Energieanbieter höhere Abschläge fordern, lesen Sie im verlinkten Artikel.
Darf der Versorger meinen Strom- und Gasverbrauch schätzen?
Schätzungen des Stromverbrauchs sind in der Grundversorgung und in Sonderverträgen mittlerweile einheitlich geregelt und nur in wenigen Fällen zulässig. Hier einige Beispiele, wann eine Schätzung zulässig ist:
- Der Ableser konnte ein Grundstück oder die Räume von Kund:innen zur Zählerablesung nicht betreten, weil sie den Zugang vereitelt haben.
- Kund:innen waren verpflichtet, den Stromverbrauch selbst abzulesen. Das haben sie aber nicht oder erst verspätet getan.
- Der Arbeitspreis hat sich innerhalb des Abrechnungszeitraums geändert. Dann darf der Grundversorger den Verbrauch "pauschal zeitanteilig berechnen" und somit eine Art Schätzung vornehmen. Entscheidend ist hier der Preis für den verbrauchten Strom, nicht der Grundpreis.
- Der Zähler funktioniert nicht oder nicht richtig. Oder der Rechnungsbetrag wurde falsch berechnet, ohne dass die Fehlerquelle eindeutig feststellbar ist.
- Während der Ersatzversorgung darf geschätzt werden. Die übernimmt der örtliche Grundversorger automatisch für maximal 3 Monate, wenn ein Lieferantenwechsel scheitert oder der aktuelle Stromversorger wegen Insolvenz nicht mehr liefert.
Wie kann ich eine Schätzung des Zählerstands verhindern?
Sie haben dazu im Prinzip nur eine Möglichkeit: Lesen Sie den Verbrauch selbst ab und übermitteln Sie die Daten fristgerecht dem Versorger. Am besten schriftlich. Um einen Nachweis zu haben, können Sie den Zählerstand fotografieren oder gemeinsam mit einem Zeugen ablesen.
Viele Energiekund:innen wissen gar nicht, dass ein Versorger ihren Verbrauch schätzen darf und wie die Voraussetzungen dafür sind.
Was tun, wenn die Schätzung unzulässig war?
- Überprüfen Sie, ob die in der Rechnung angegebenen Gründe für die Schätzung tatsächlich vorgelegen haben.
- Fordern Sie den Anbieter auf, dass er Ihnen die Schätzung in Textform erläutert.
- Sollten Sie feststellen, dass die angegebenen Gründe nicht vorgelegen haben und die Erläuterung nicht nachvollziehbar ist, dann weisen Sie den Versorger darauf hin, dass die Schätzung aus Ihrer Sicht unzulässig war.
- Lassen Sie checken, ob die Schätzwerte plausibel sind. Die Beraterinnen und Berater der Verbraucherzentralen helfen Ihnen dabei.
- Lesen Sie den Verbrauch zusammen mit einem Zeugen am Zählerstand selbst ab und teilen Sie das Ergebnis dem Anbieter am besten schriftlich mit.
- Fordern Sie den Versorger auf, die Abrechnung zu korrigieren und die Abschläge anzupassen.
- Für die Grundversorgung stellt der Bundesgerichtshof klar, dass nicht bereits die unzulässige Schätzung zu einem Zahlungsverweigerungsrecht des Verbrauchers führt. Ein Zahlungsverweigerungsrecht kann nur dann bestehen, wenn eine fehlerhafte Rechnung zu einer "den Verbraucher benachteiligenden objektiven Unrichtigkeit der Rechnung, also zu einer Zuvielforderung führt". Das Recht, Geld zurückzubehalten, umfasst in diesem Fall auch nur die Zuvielforderung. Keinesfalls dürfen Sie die gesamte Zahlung verweigern. (BGH, Az. VIII ZR 243/12, Urteil vom 16. Oktober 2013)
Wenn die Schätzung unzulässig war, die Ablesung im Nachhinein nicht mehr möglich ist und Sie die geschätzten Verbrauchswerte bestreiten, dann kann auch ein Gericht Ihren Verbrauch schätzen.
Wie lange darf ein Versorger eine Nachzahlung für einen zu gering geschätzten Verbrauch fordern?
Grundsätzlich liegt die regelmäßige Verjährungsfrist bei 3 Jahren. Dies setzt juristisch allerdings die Fälligkeit voraus, d.h. einen festen Zeitpunkt, wann die Rechnung zu bezahlen ist. Energieforderungen werden frühestens 2 Wochen, nachdem die Rechnung dem Verbraucher zugegangen ist, fällig (§ 40c Abs. 1 S. 1 EnWG / § 17 Abs. 1 S. 1 StromGVV/GasGVV). Die Verjährungsfrist ist also erst frühestens 2 Wochen nach Zugang der Rechnung beginnen. Dies gilt auch für eine Energierechnung, die auf geschätzten Verbrauchswerten erstellt wird.
Die Rechtsprechung nimmt darüber hinaus allerdings auch noch an, dass Sie als Verbraucher:in den gesamten Verjährungszeitraum über mit einer Korrektur rechnen müssen. Denn die Verbräuche wurden ja lediglich geschätzt. Damit wurde zum Ausdruck gebracht, dass die Erfassung der Verbrauchswerte nicht endgültig ist.
Gut zu wissen: Ein Verbrauch, der in der Abrechnung nicht erfasst wurde, also eine zu niedrige Verbrauchsschätzung, kann nicht verjähren. Deshalb kann ein Versorger die Nachzahlung auf unbestimmte Zeit einfordern.