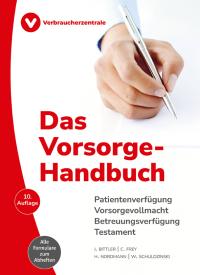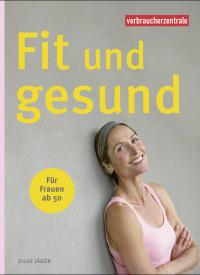Wie kommt eine App ins DiGA-Zulassungsverzeichnis?
Hat das BfArM eine App geprüft und in das DiGA-Verzeichnis aufgenommen, kommt sie in eine Testphase. Für ein Jahr tragen dann die Krankenkassen die Kosten der App. Die App-Anbieter müssen in dieser Zeit nachweisen, dass ihre Software zu einer besseren medizinischen Versorgung der Nutzer:innen beiträgt. Liefern sie Nachweise für positive Versorgungseffekte, wird die App dauerhaft in das Verzeichnis aufgenommen. Liefern sie nur Hinweise für positive Versorgungseffekte, erfolgt eine vorläufige Aufnahme ins Verzeichnis für 12 Monate.
Die Regeln gelten nicht nur für neue Apps. Auch bereits verfügbare Anwendungen können bei positiver Prüfung in das Verzeichnis aufgenommen werden. Den Antrag muss jedoch der Hersteller stellen.
Einen Antrag auf Prüfung können Anbieter seit Mitte Mai 2020 beim BfArM einreichen. Im sogenannten Fast-Track-Verfahren prüft das BfArM innerhalb von 3 Monaten die Angaben des Herstellers. Für die DiGa-Liste kommen nur Apps mit einem CE-Zeichen in Frage.
Verschreibt Ihr Arzt oder Ihre Ärztin Ihnen eine App und tauchen Fragen dazu auf oder zweifeln Sie an ihrem Nutzen, sprechen Sie am besten mit ihm oder ihr.
Wie bekomme ich eine geprüfte App aus dem DiGA-Verzeichnis?
Ärzt:innen und Psychotherapeut:innen können Apps aus dem DiGA-Verzeichnis verordnen. Sie sind dazu allerdings nicht verpflichtet. Das Rezept müssen gesetzlich Versicherte bei ihrer Krankenkasse einreichen. Sie erhalten dann einen Code, mit dem sie die App kostenfrei herunterladen und freischalten können.
Noch werden DiGA nicht regelmäßig verordnet, um Behandlungen zu unterstützen oder mit Krankheiten besser umzugehen. Die Zahl steigt aber langsam an.
Gibt es für Gesundheits-Apps nicht längst einheitliche Qualitätskriterien?
Neben den DiGA gibt es in den App-Stores unzählige Gesundheits-Apps, die Sie herunterladen können.
Wichtig zu wissen: Für diese Apps gibt es bislang noch keine einheitlichen Qualitätskriterien. Auch müssen keine Angaben gemacht werden, welchem Zweck sie dienen, wo sie eingesetzt werden, wer die Nutzergruppen sind und wofür sie nicht eingesetzt werden sollten. Grundsätzlich stellt sich bei jeder App die Frage, ob die Informationen richtig sind und aus welchen Quellen sie stammen.
Die meisten Apps in diesem schnelllebigen Markt sind nicht wissenschaftlich auf ihren Nutzen hin untersucht. So kann es hilfreiche Apps geben, aber auch solche, deren Nutzen nicht belegt ist und die schlimmstenfalls sogar Schaden anrichten können, etwa durch falsche Messungen und Diagnosen.
Umso wichtiger ist es, dass Sie Apps, die mehr als kleine Gimmicks, wie etwa Schrittzähler, bieten, mit Ihrem Hausarzt oder Ihrer Hausärztin besprechen. Eine erste Orientierung bietet zum Beispiel die Plattform HealthOn, die digitale Gesundheitsanwendungen bewertet.
Wie sicher ist der Datenschutz?
Grundsätzlich sind viele Apps sehr kritisch zu bewerten, was den Datenschutz betrifft. In vielen Gesundheits-Apps werden sensible Daten erhoben, gespeichert und verarbeitet.
Als Nutzer:in wissen Sie bei vielen Apps nicht, wem Sie sensible Daten anvertrauen. Expert:innen sehen darin ein großes Problem. Es empfiehlt sich auf jeden Fall, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen einer App zu lesen und zu prüfen, welche Daten die App abruft und ob sie diese eventuell an Dritte weiterleitet.
Schon der Download einer App hinterlässt Spuren. Deshalb wurde auch diskutiert, ob für Apps, die von Ärzt:innen verordnet und von Krankenkassen bezahlt werden, App-Stores oder Google Play als Bezugsquelle sind.
Gut zu wissen: Bei den geprüften medizinischen Apps im DiGA-Verzeichnis können Sie sicher sein, dass der Datenschutz einen großen Raum einnimmt. Die Apps auf Rezept müssen unter anderem frei von Werbung sein. Personenbezogene Daten dürfen nicht zu Werbezwecken verwendet werden und medizinische Inhalte und Gesundheitsinformationen müssen dem allgemein anerkannten fachlichen Standard entsprechen.
Wie sollte ich eine App auswählen?
Mit den folgenden Fragen wollen wir Ihnen eine Orientierungshilfe geben:
- Welche Funktion soll die App erfüllen? Stimmt die tatsächliche Funktion mit der versprochenen überein?
Achtung: Gratis-Programme haben oft einen sehr begrenzten Funktionsumfang. Wer mehr will, muss zahlen. - Wer ist der Hersteller der App: ein wissenschaftliches Institut, Mediziner, Pharmaunternehmen, Krankenkassen? Hat jemand ein Interesse daran, Ihnen seine Produkte zu verkaufen?
- Wie wird die App finanziert? Wird Werbung eingeblendet, werden Sponsoren genannt?
Achtung: gerade kostenlose Apps finanzieren sich über Datenhandel und Werbung. - Sind die Ratschläge und Informationen verständlich?
- Sind die ausgegebenen Daten/Werte plausibel? Unterscheiden sich die gemessenen Werte (zum Beispiel Blutzuckerwerte) erheblich von den vom Arzt gemessenen Werten?
- Wird bei kritischen Werten darauf hingewiesen, einen Arzt zu Rate zu ziehen?
- Was soll die App können, was muss sie daher von Nutzer:innen verlangen? Braucht die App zum Beispiel Zugriff auf das Adressbuch, obwohl sie nur eine reine Dokumentationsfunktion hat?
Fragen Sie sich, ob die geforderten Zugriffberechtigungen tatsächlich für die Funktion der App notwendig sind. - Gibt es Hinweise zur Weitergabe von Daten an Dritte und wenn ja, an wen und zu welchem Zweck werden die Daten weitergegeben?
- Wo werden die Daten gespeichert: auf Ihrem Smartphone oder Tablet oder extern beim Anbieter?
Achtung: Bei einer externen Speicherung verlieren Sie möglicherweise die Kontrolle über die Daten.