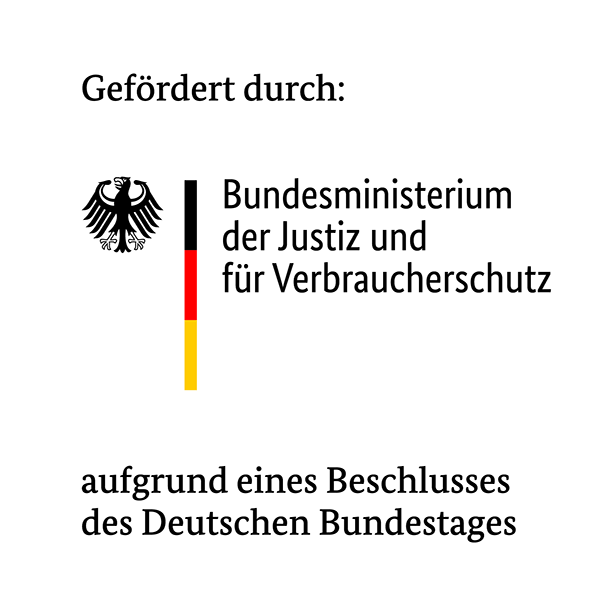Das Wichtigste in Kürze:
- Nur wenige Produkte haben bislang eine nachweisbare nachhaltige Wirkung (sogenannte Impact-Produkte).
- Am Namen eines Produktes ist nicht erkennbar, ob es tatsächlich Wirkung entfaltet.
- Besonders bei Investmentfonds und ETFs ist der Nachweis von Wirkung schwierig.
Wirkung: Erwartungen und Realität
Viele Verbraucher:innen gehen davon aus, dass nachhaltige Geldanlagen automatisch etwas Positives für Umwelt oder Gesellschaft bewirken. Eine Studie der Universität Kassel sowie Umfragen der Verbraucherzentrale Bremen und des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) zeigen: Genau diese Erwartung ist für viele der entscheidende Grund, sich für nachhaltige Produkte zu entscheiden.
In der Realität jedoch können nur wenige Produkte eine nachhaltige Wirkung (Impact) tatsächlich nachweisen. Der Großteil der Angebote orientiert sich an ESG-Standards (Environmental, Social, Governance). ESG-Kriterien sollen in erster Linie Nachhaltigkeitsrisiken reduzieren – nicht zwingend eine konkrete Wirkung erzeugen.
Wirkung hängt von der Produktklasse ab
Die Wirkung einer Geldanlage unterscheidet sich je nach Produkt:
- Direktinvestitionen, etwa in erneuerbare Energien oder die Investition in Mikrofinanzfonds – lassen sich leichter nachvollziehen. Eine Orientierung bietet die Impact-Datenbank von MY FAIR MONEY. Grundlage ist das Impact Potential Assessment Framework (IPAF). Aufgeführt sind Finanzprodukte mit hohen Impact-Bewertungen.
- Investmentfonds und ETFs – hier ist es schwieriger. Die Fonds erwerben Wertpapiere meist über den Sekundärmarkt . Das bedeutet: Aktien etwa werden nicht von dem Unternehmen erworben, an dem man sich beteiligt, sondern vom Vorbesitzer. Es fließt kein neues Geld an das Unternehmen, wie das bei einer Aktienneuemission der Fall wäre.
Engagement: Einfluss durch Stimmrechte
Ein wichtiger Hebel für Wirkung ist das sogenannte Engagement. Gemeint ist damit die Einflussnahme von Aktionär:innen auf Unternehmen – etwa durch Rede- und Stimmrechte auf Hauptversammlungen.
Oft vertreten Fondsgesellschaften die Anteile ihrer Anleger:innen und versuchen, Unternehmen zu einem nachhaltigeren Kurs zu bewegen. Ob und wie intensiv sie diesen Einfluss nutzen, ist für Außenstehende jedoch schwer zu erkennen. Manche Ergebnisse werden veröffentlicht, vieles aber findet hinter verschlossenen Türen statt.
Neue Regeln für Fondsnamen
Seit dem 21. Mai 2025 gelten europaweit einheitliche Regeln, wann ein Fonds Nachhaltigkeitsbegriffe im Namen tragen darf. Grundlage sind die Leitlinien der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA).
- Mindestens 80 Prozent der Anlagen müssen den deklarierten Nachhaltigkeitsparametern entsprechen.
- Die restlichen 20 Prozent müssen immerhin gewisse Ausschlusskriterien einhalten.
Die Leitlinien unterscheiden verschiedene Kategorien von Begriffen:
- Transformation (z. B. „Netto-Null“, „Fortschritt“)
- Umwelt (z. B. „grün“, „klimafreundlich“, „ESG“)
- Soziales (z. B. „sozial“, „Gleichstellung“)
- Unternehmensführung (z. B. „Governance“)
- Wirkung (z. B. „Impact“)
- Allgemein Nachhaltigkeit (z. B. „nachhaltig“, „Sustainability“)
Zusätzlich gelten verbindliche Mindestausschlüsse. So dürfen Fonds mit Begriffen wie „Impact“ oder „Öko“ nicht in Unternehmen investieren, die mehr als 1 % ihrer Einnahmen mit Kohle oder mehr als 10 % mit Öl erwirtschaften. Auch Unternehmen, die kontroverse Waffen oder Tabakprodukte herstellen oder gegen UN-Prinzipien verstoßen, sind ausgeschlossen.
Einstufung nach der Offenlegungsverordnung
Fonds mit Nachhaltigkeitskriterien ordnen sich häufig nach Artikel 8 oder Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung ein. Oft wird die Einordnung nach Artikel 8 gleichgesetzt mit ‘hellgrün’ oder ‘ESG’-Fonds und die nach Artikel 9 mit Impact-Fonds – doch das stimmt so nicht.
Die Einstufung sagt lediglich etwas darüber, wie ausführlich ein Anbieter über Nachhaltigkeitsaspekte berichtet. Ob ein Fonds wirklich Wirkung entfaltet, ist damit nicht festgelegt.
Eine Studie der Universität Hamburg (2023) zu 1.000 Fonds mit Artikel-9-Einstufung zeigt:
- Nur 60 % verfolgten tatsächlich eine wirkungsorientierte Strategie.
- 40 % setzten lediglich auf allgemeine ESG-Strategien.
Die Fachwelt fordert deshalb eine Überarbeitung der Offenlegungsverordnung – die EU-Kommission arbeitet daran.
Wirkung messen und nachweisen
Gerade bei Investmentfonds und ETFs steckt der Nachweis nachhaltiger Wirkung noch in den Kinderschuhen. Gründe dafür:
- Mangelnde Transparenz und schwer verständliche Produktinformationen.
- Werbeversprechen, die sich nicht belegen lassen (Stichworte: Greenwashing und Impactwashing).
- Unklare Fragen: Welche Messmethoden sind geeignet? Ab wann gilt eine Wirkung als signifikant?
Ein Gutachten aus 2021 unterscheidet drei mögliche Wirkungskanäle nachhaltiger Geldanlagen:
- Direkt durch Renditeverzicht
- Direkt durch Einfluss auf das Management (Engagement)
- Indirekt durch weitere Mechanismen
Die Autor:innen kommen zum Schluss: Private Anleger:innen können eher indirekt transformative Wirkungen erzielen – etwa indem Unternehmen attraktiver für Fachkräfte und Kund:innen werden oder bessere Kreditkonditionen erhalten. Auch politische Entscheidungen könnten dadurch erleichtert werden. Diese Effekte könnten groß sein, allerdings: Sie sind bisher kaum messbar.
Company Impact vs. Investor Impact
Für die Bewertung der Wirkung ist die Unterscheidung wichtig:
- Company Impact: Die tatsächlichen Auswirkungen eines Unternehmens auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft.
- Investor Impact: Die Wirkung, die durch die Investition selbst entsteht – etwa, weil Investor:innen nachhaltige Unternehmen fördern oder Druck auf andere ausüben.
Investor Impact kann bewirken, dass nachhaltigere Firmen schneller wachsen oder dass andere Unternehmen ihre Strategie ändern. Auch kann er andere Investor:innen beeinflussen – und so Teil einer größeren Bewegung sein.
Fazit
Viele Verbraucher:innen erwarten von nachhaltigen Geldanlagen eine klare Wirkung. Die wissenschaftliche und regulatorische Diskussion dazu steckt jedoch noch in den Anfängen.
Einige Anbieter versprechen mehr, als sie belegen können. Messung und Nachweis sind oft schwierig bis unmöglich.
Tipp: Prüfen Sie Produkte genau, bevor Sie investieren. Wer wirkungsorientiert anlegen möchte, sollte sich informieren und kritisch abwägen.