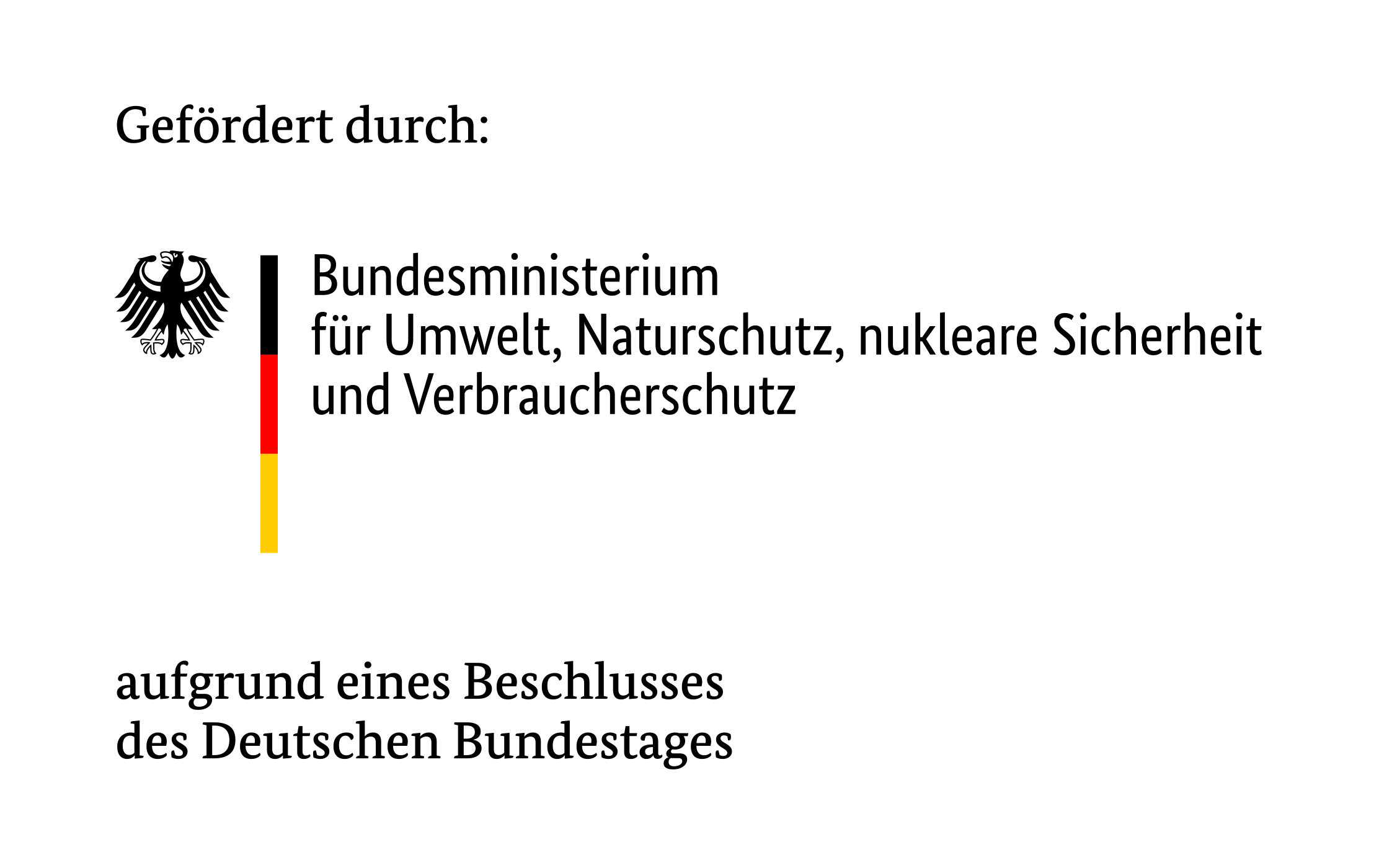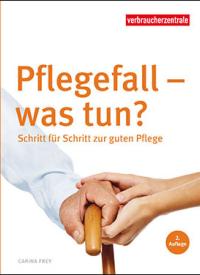Das Wichtigste in Kürze:
- Bei Entlassung kann die Klinik Verband-, Heil- und Hilfsmittel, häusliche Krankenpflege sowie Soziotherapie (zum Beispiel psychosoziale Unterstützung) für bis zu 7 Tage verordnen. Darüber hinaus kann Arbeitsunfähigkeit bescheinigt werden.
- Nach dem Krankenhausaufenthalt sind bei Bedarf häusliche Krankenpflege, Haushaltshilfe, Kurzzeitpflege oder ambulante und stationäre Reha-Maßnahmen möglich.
- Auch Rehabilitationseinrichtungen sind verpflichtet, die Anschlussversorgung zu organisieren und sicher zu stellen.
Was bedeutet Entlassmanagement?
Entlassmanagement ist die geplante Überleitung von Patient:innen aus dem Krankenhaus in die Versorgung außerhalb des Krankenhauses. Die Klinik muss für einen möglichst reibungslosen Übergang von Patient:innen in die weitere Versorgung sorgen. Gesetzlich Versicherte haben einen gesetzlichen Anspruch auf ein Entlassmanagement.
Krankenhäuser sind verpflichtet, Patient:innen schriftlich oder elektronisch über Ziele und Inhalte des Entlassmanagements zu informieren. Die Teilnahme der Patienten ist freiwillig. Dem Entlassmanagement und der dabei erforderlichen Datenübermittlung an weiterversorgende Therapeut:innen und Einrichtungen müssen Patienten mit ihrer Unterschrift zustimmen.
Bestehen Sie auf ein Entlassmanagement und auf frühzeitige Einleitung der erforderlichen Maßnahmen! Nehmen Sie Kontakt zum Sozialdienst des Krankenhauses auf und gegebenenfalls zur Pflegeberatung vor Ort. Im besten Fall ist alles organisiert, wenn Sie das Krankenhaus verlassen - vom Pflegebett über einen Toilettenstuhl bis hin zum passenden Pflegegrad und den richtigen Medikamenten.
Was ist ein Entlassplan?
Der Entlassplan ist Grundlage für das Entlassmanagement. In ihm legt das Krankenhaus alle Leistungen fest, die aus medizinisch-pflegerischer Sicht unmittelbar nach der Entlassung notwendig sind. In der Regel kümmert sich der Sozialdienst eines Krankenhauses um das Entlassmanagement.
Deshalb ist es wichtig, so früh wie möglich Kontakt zum Sozialdienst aufzunehmen, denn Patient:innen und Angehörige sind oft überrascht, wie schnell eine Entlassung seitens des Krankenhauses geplant wird. Damit der Sozialdienst die Versorgungsituation zuhause beurteilen kann, wird er mit Ihnen die relevanten Fragen besprechen. Dadurch kann er dann entscheiden, was Sie in Ihrer individuellen Situation benötigen.
Das Krankenhaus muss dann die entsprechenden Maßnahmen frühzeitig einleiten und dazu mit der Kranken- und Pflegekasse Kontakt aufnehmen. So können bereits im Krankenhaus alle entsprechenden Anträge gestellt und von der Kranken- oder Pflegekasse bewilligt werden. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn ein Pflegebedarf festgestellt wird. Dann kann ein Antrag auf Feststellung einer Pflegebedürftigkeit oder Höherstufung gestellt werden. Der Sozialdienst hilft bei der Antragstellung.
Außerdem wird Kontakt zum ambulanten Pflegedienst oder stationären Pflegedienst gehalten, der zum Beispiel über den Termin Ihrer bevorstehenden Entlassung informiert wird.
Damit die Ärztinnen und Ärzte nach dem Krankenhausaufenthalt in der Anschlussbehandlung auch wissen, was zu tun ist, erhalten Sie einen Entlassbrief, in dem alle wichtigen Informationen über Ihre Behandlung und notwendige Maßnahmen enthalten sind.
Welche Anschlussversorgungen können gewählt werden? Im Anschluss an den Aufenthalt im Krankenhaus kann bei einigen Patient:innen eine stationäre Rehabilitationsmaßnahme notwendig sein.
Andere Patient:innen benötigen auch nach der Entlassung Behandlungsmaßnahmen oder bestimmte Arznei-, Heilmittel (Therapien wie Physiotherapie, Ergo- oder Logopädie) oder bestimmte Hilfsmittel. Manche sind trotz Beendigung der Krankenhausbehandlung zu Hause noch auf Hilfe bei der Körperpflege oder im Haushalt angewiesen.
Auch Rehabilitationseinrichtungen sind verpflichtet, für Patient:innen in stationären Rehabilitationseinrichtungen ein Entlassmanagement zu organisieren. Dazu gehört, dass sie feststellen, welche ambulanten Leistungen zur Überbrückung der Übergangsphase von der stationären in die ambulante Behandlung erforderlich sind und diese einleiten.
Wer kümmert sich um das Entlass-Management?
Ansprechpartner:in für Patient:innen sind sowohl
- das ärztliche Personal,
- das Pflegepersonal,
- als auch der Sozialdienst des Krankenhauses.
Im Idealfall arbeiten Ärzte und Ärztinnen, Psychotherapeut:en, andere Therapeuten, Pflegepersonal und Sozialdienst in einem multidisziplinären Team zusammen. Bei Schwierigkeiten können sich Patient:innen auch an den Patientenfürsprecher wenden.
In Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und Thüringen muss jedes Krankenhaus solche Ansprechpartner:innen haben. Ansonsten können sich Patient:innen auch an das Beschwerde-Management des Krankenhauses wenden.
Kann die Klinik Leistungen für die Zeit nach dem Aufenthalt im Krankenhaus verordnen?
Das Krankenhaus kann für kurze Zeiträume nach der Krankenhausbehandlung selbst
- Verbandmittel,
- Heilmittel (beispielsweise Physiotherapie, Ergotherapie oder Logopädie) und Hilfsmittel,
- häusliche Krankenpflege,
- spezialisierte ambulante Palliativversorgung,
- Krankenbeförderung (Entlassfahrt),
- Soziotherapie (psychosoziale Begleitung) und
- digitale Gesundheitsanwendungen
verordnen.
Patient:innen müssen sich dann nicht extra noch eine Versorgung bei der hausärztlichen Praxis besorgen. Dadurch bleibt ihnen ein zusätzlicher Praxisbesuch erspart.
Das Krankenhaus kann maximal für 7 Tage nach dem Verlassen des Krankenhauses Leistungen verordnen. Ist die Verordnung dieser Leistungen über 7 Tage hinaus nötig, müssen sich die Patient:innen eine weitere Verordnung bei Haus- oder Fachärzt:innen besorgen.
Wie wird die Medikamentenversorgung sichergestellt?
Für die Medikamentenversorgung unmittelbar nach einem Krankenhausaufenthalt gibt es 2 Möglichkeiten:
- Die Klinik kann in bestimmten Fällen Patient:innen bei Entlassung die benötigten Medikamente direkt mitgeben. Das geht, wenn die Entlassung vor oder an einem Wochenende oder Feiertag erfolgt. Die Krankenhaus-Apotheke darf nur so viele Medikamente mitgeben, wie zur Überbrückung dieser Tage notwendig sind. Unabhängig davon darf das Krankenhaus für längstens 3 Tage Medikamente mitgeben, wenn bei Entlassung eine Verordnung über häusliche Krankenpflege vorliegt.
- Darüber hinaus kann eine Klinik zusätzlich bei Entlassung auch Medikamente verordnen. Maximal ist dabei eine Verordnung für eine Packung mit der kleinsten Packungsgröße (N1) möglich. Versicherte müssen sich die so verordneten Medikamente nach der Entlassung in einer Apotheke besorgen. Sie werden nicht durch das Krankenhaus mitgegeben.
Können Krankenhäuser Patient:innen „krank" schreiben?
Krankenhäuser dürfen für die Zeit nach der Entlassung Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen für bis zu 7 Tage ausstellen. So werden Lücken in Bescheinigung von Arbeitsunfähigkeit vermieden.
Was passiert bei Pflegebedarf?
Ist nach einem Krankenhausaufenthalt weiterhin pflegerische Unterstützung notwendig, kommen zwei mögliche Kostenträger in Betracht:
- die Krankenkasse
- und die Pflegekasse.
Welcher Kostenträger die Kosten übernimmt, hängt von der Art der erforderlichen Pflege und dem Vorliegen von weiteren Voraussetzungen ab. Bei der Antragstellung unterstützt Sie ebenfalls der Sozialdienst des Krankenhauses.
Behandlungspflege: Wer übernimmt die Kosten?
Benötigt der Patient nach der Krankenhausentlassung Hilfe bei Tätigkeiten, die auf die Behandlung der Krankheit abzielen, wie etwa Verbandswechsel oder Medikamentengabe, kommt nur die Krankenkasse als Kostenträger in Frage. Reichen Sie dazu eine ärztliche Verordnung bei der Krankenkasse zur Prüfung ein.
Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung
Unter dem Begriff Grundpflege versteht man Hilfestellung bei
- der Körperpflege,
- der Ernährung und
- der Mobilität (zum Beispiel Hilfe beim Duschen, Essen oder Ankleiden).
Für Leistungen der Grundpflege und der hauswirtschaftlichen Versorgung kommen sowohl die Pflegekasse als auch die Krankenkasse als Kostenträger in Betracht.
Für Leistungen der Grundpflege und der hauswirtschaftlichen Versorgung kommen sowohl die Pflegekasse als auch die Krankenkasse als Kostenträger in Betracht. Sind Patient:innen pflegebedürftig in den Pflegegraden 2, 3, 4 oder 5 nach dem Sozialgesetzbuch XI, besteht ein Anspruch gegenüber der Pflegekasse. Die Höhe der Leistungen richtet sich nach dem jeweiligen Pflegegrad.
Ist das nicht der Fall, beispielsweise weil Sie nur kurzzeitig pflegedürftig sind, das heißt weniger als 6 Monate, oder weil nur Pflegebedürftigkeit nach dem Pflegegrad 1 besteht, kommt eine Kostenübernahme durch die Krankenkasse in Form von häuslicher Krankenpflege oder Haushaltshilfe in Frage.
Hierzu benötigen Sie die Verordnung Ihres behandelnden ärztlichen Fachpersonals und müssen dann bei Ihrer Krankenkasse einen Antrag zu stellen.
Wann kann ich Kurzzeitpflege in Anspruch nehmen?
Ist eine Pflege zu Hause nicht möglich oder nicht ausreichend, kann ein vorübergehender Aufenthalt in einer stationären Pflegeeinrichtung als Kurzzeitpflege erforderlich sein.
Auch hier kommen sowohl die Pflege- als auch die Krankenkasse als Kostenträger in Betracht. Liegt Pflegebedürftigkeit in den Pflegegraden 2, 3, 4 oder 5 vor, besteht ein Anspruch gegenüber der Pflegekasse.
Liegt keine Pflegebedürftigkeit oder nur ein Pflegegrad 1 vor, kommt die Krankenkasse als Kostenträger in Frage. Dazu müssen Sie bei der Krankenkasse ein Antrag auf Kurzzeitpflege stellen. Auch dabei unterstützt Sie der Soziale Dienst des Krankenhauses.
Ein Anspruch auf Kurzzeitpflege besteht in beiden Fällen für höchstens 8 Wochen und für einen maximalen Leistungsbetrag von 1.774 Euro. Kosten für
- Unterkunft,
- Verpflegung
- und Investitionskosten
müssen Patient:innen selbst tragen.
Häufig ist bei der Krankenhausentlassung unklar, ob ein Pflegegrad vorliegt, weil der Antrag auf Pflegeleistungen gerade erst gestellt wurde und eine Begutachtung zur Pflegebedürftigkeit durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung noch nicht stattgefunden hat.
In dieser Situation sollten sowohl Leistungen der Pflegeversicherung als auch entsprechende Leistungen bei der Krankenkasse beantragt werden. Dann kann - bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen - zunächst die Krankenkasse die Kosten übernehmen.
Wird später rückwirkend beim Versicherten das Vorliegen von Pflegebedürftigkeit in den Graden 2, 3, 4 oder 5 nach dem SGB XI festgestellt, kann sich die Krankenkasse die Leistungen von der Pflegekasse erstatten lassen.
Wann kann ich Übergangspflege bekommen?
Wenn im Anschluss an den Krankenhausaufenthalt die weitere Versorgung nicht oder nur mit erheblichen Aufwand sichergestellt werden kann, kann eine Übergangspflege in Betracht kommen.
Damit ist eine weitere pflegerische Versorgung bis zu 10 Tage in dem Krankenhaus, in dem die Patient:innen behandelt wurden, möglich. Dies muss im Voraus bei der Krankenkasse beantragt werden. Auch hier unterstützt der Sozialdienst.